Barlachs Kunst
Barlachs Kunst in der Antoniterkirche
Mit dem „Schwebenden“, dem „Lehrenden Christus“ und dem „Kruzifix II“ beherbergt die Antoniterkirche Köln drei Ausstattungsstücke von der Hand des Künstlers Ernst Barlach.
"Der Schwebende" oder "der Barlach-Engel"
Eine überlebensgroße menschliche Figur schwebt in waagerechter Lage. Der Rücken ist gerade, die Arme sind vor der Brust gekreuzt. Als Ernst Barlach die Gesichtszüge des Schwebenden modellierte, hatte er Käthe Kollwitz im Sinn. Er selbst sagte: „Die Züge von Käthe Kollwitz sind mir da so hereingekommen. Hätte ich mir das vorgenommen, so wäre es mir nicht gelungen.“ Die Skulptur ist über Kopfhöhe im Seitenschiff angebracht. Ernst Barlach wollte, dass um den Engel ein Raum der Ruhe entsteht. Deshalb soll das einfallende Licht gedämpft sein und nicht blenden.
Der Schwebende wurde 1926/27 von Ernst Barlach (1870-1938) anlässlich der 700-Jahr-Feier des Doms zu Güstrow und zur Erinnerung an die Toten des gerade überstandenen Weltkrieges geschaffen. Als Mahnmal für die Opfer des Krieges war der Schwebende damals eine revolutionäre Neuerung. Andere Kriegsdenkmale dienten der Glorifizierung und der Heroisierung der Gestorbenen und sollten für weitere Generationen einen Anreiz geben. Deshalb wurden die Soldaten, so sie denn im Denkmal dargestellt waren, als Helden, als Heroen, als nackte, schöne Kämpfer dargestellt. All dies wollte Barlach nicht. Er hat mit der Engelsfigur ein Denkmal im wahrsten Sinne des Wortes geschaffen: ein Mahnmal, ein Mal zum Nachdenken über die Opfer und über das Leid des Krieges.
Dann aber kam die Zeit des Nationalsozialismus: Ernst Barlach war einer jener Künstler, die von der nationalsozialistischen Aktion „Entartete Kunst“ betroffen waren: die meisten seiner Werke wurden ab 1937 von öffentlichen Plätzen und aus Museen entfernt. Er erhielt Ausstellungsverbot.
Auch in Güstrow bildete sich eine Front gegen diesen „entarteten“ unheroischen Barlach-Engel im Dom. Es gab Unterschriftensammlungen, offizielle Eingaben und Auseinandersetzungen quer durch die Domgemeinde. 1937 wurde schließlich das Totenmal aus dem Dom in Güstrow entfernt und später für Kriegszwecke verschrottet.
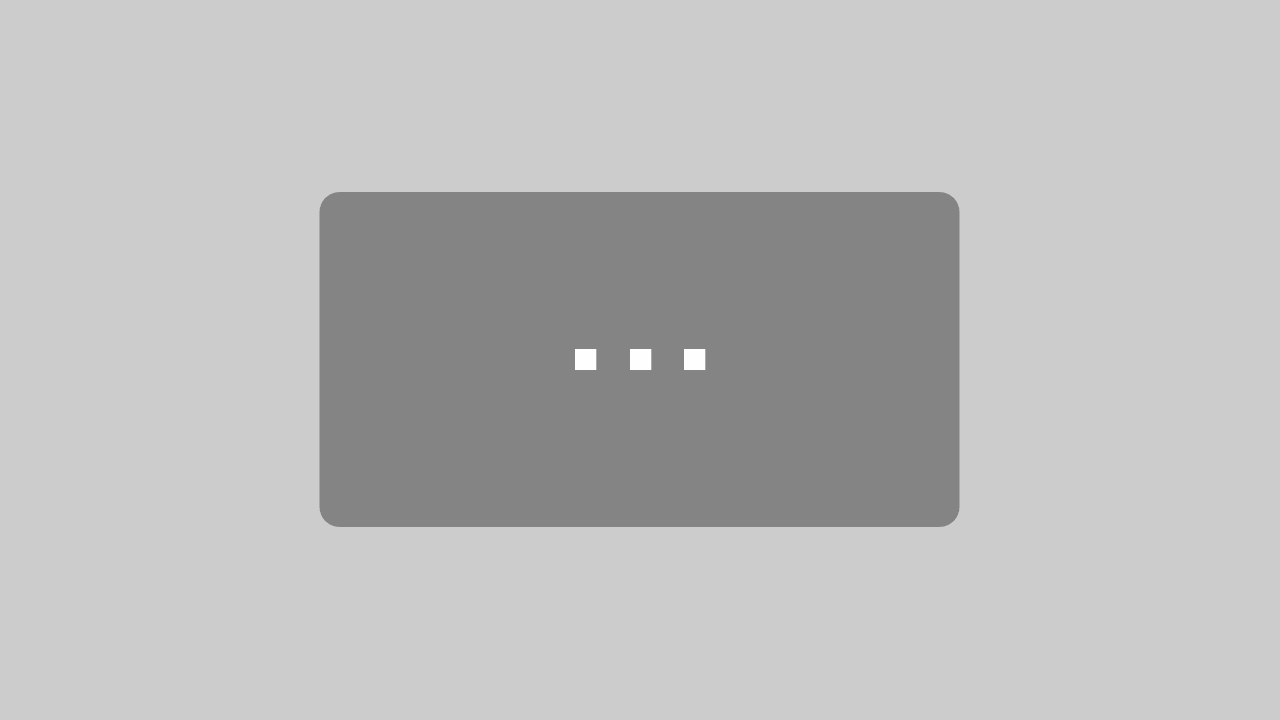
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Freunden von Barlach gelang es glücklicherweise, das Original-Werkmodell zu retten und einen Zweitguss herstellen zu lassen. Dieser überstand den Krieg versteckt beim Maler Hugo Körtinger in der Lüneburger Heide, der den Engel nach dem Krieg zum Kauf anbot. Viele Museen und Städte waren interessiert. Eine große Spendenaktion ermöglichte es jedoch, den Zweitguss des Schwebenden nach Köln zu holen – in die protestantische Antoniterkirche, wo es einen Aufstellungsort gab, der jenem im evangelischen Dom zu Güstrow, für den er gedacht war, sehr nahe kommt.
Seit 1952 hängt der Schwebende von Ernst Barlach in der Antoniterkirche. Die Grabplatte unter dem Schwebenden ist wie folgt beschriftet: „1914 – 1918, 1933 – 1945“ und verweist damit nicht nur auf den Ersten Weltkrieg, sondern zusätzlich auf die Schreckensherrschaft der nationalsozialistischen Diktatur, in der auch von Beginn an Barlachs Werk verfemdet wurde. Ein vom Kölner Engel abgenommener weiterer Guss wurde 1953 der Domgemeinde in Güstrow als Geschenk der Evangelischen Gemeinde Köln übergeben.
"Kruzifix II"
Das Kruzifix II, ein Guss des 1918 von Ernst Barlach geschaffenen „Christus“, ist auf der Stirnseite des südlichen Seitenschiffes angebracht.
Als Auftragsarbeit gefertigt, rang Barlach lange mit diesem Werk, mit dem er letztlich aber doch sehr zufrieden war. In einem Brief schreibt er 1918: „Der Christus hat mir manchen schweren Tag gemacht, aber am Ende hatte ich doch das Gefühl, dass er so sein müsste, wie er wurde.“
Das Kruzifix II ist eine Stiftung des Ehepaars Dr. Mariana Hanstein und Professor Henrik Hanstein.
So sind nun sowohl in der Kölner Antoniterkirche als auch im Dom zu Güstrow in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Schwebenden Barlachs Kruzifixe zu sehen.
"Der Lehrende Christus"
Die Bronzeplastik (Werkverzeichnis: Laur 474; Schult 373) hat eine Höhe von 87,5 cm. Sie ist an der linken Seite des Sockels signiert und datiert „E. Barlach / 1931“ sowie rückseitig links unten mit dem Gießerstempel „H. NOACK BERLIN“ versehen. Nach dem 1931 entstandenen Gipsmodell (Laur 473) wurde 1938, also im Jahr von Ernst Barlachs Tod, eine Bronze hergestellt. Posthum wurden seit 1950 14 unnumerierte Exemplare gegossen. Einer dieser posthumen Güsse ist nun in der Antoniterkirche Köln, aufgestellt gegenüber von Barlachs Kruzifix II.
Die schlichte Gewandfigur wie auch die abstrakte Stilisierung des Kopfes des „Lehrenden Christus“ erinnert an die Überlieferungen abendländischer Kunst, an den strengen und jenseitig ausgerichteten Ausdruckscharakter religiöser und meditativer Andachtsbilder. Doch scheint ein anderes inhaltliches Moment hinzugekommen zu sein: die thronende Gestalt im „Lehrenden Christus“ Ernst Barlachs erfährt eine Verlebendigung durch den offenen Gestus und die suggerierte Ansprache. Auf das Niveau des Betrachters heruntergeholt, sitzt sie wie predigend inmitten der Zuhörer. Der überzeitliche, transzendentale Charakter des Göttlichen erfährt eine Erweiterung und Ergänzung durch eine neue menschliche Nähe und Zuwendung, die die mystische Vorstellung einer Erlösung durch die Menschwerdung Gottes mit der Idee eines aufgeklärten, humanistischen Christentums verbindet:
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ (Prolog des Johannes-Evangeliums, Joh. 1, 1)
Führungen zu Barlach-Kunstwerken in der AntoniterCityKirche
Die AntoniterCityTours bieten regelmäßig Führungen etwa durch die Antoniterkirche und andere Kirchen, aber auch über Kölner Friedhöfe an. Informieren Sie sich über das Angebot und die aktuellen Termine auf der Homepage der AntoniterCityTours.
